Ich zähle meine Blogs:
Es sind 9 an der Zahl. Versuche, Vorhaben, Verirrungen. Bilanzen sind dazu da, Übersicht zu gewinnen und Korrekturen zu ermöglichen. Selten kann man sich zufrieden zurücklehnen und sich auf den Profit als Privatier freuen. Schon gar nicht, wenn es sich um ideelle Produkte handelt. "Der epikureische Garten": ein Kleingarten, "Kulturlaube" benannt, sollte ein Ort für Musik, Lesungen, Gespräche sein. Nichts könnte schöner auf uns wirken, wie die Jahreszeiten und der Duft des Gartens. Ich habe es mir zu einfach vorgestellt: es klappt so nicht. Die Details werden noch zu erörtern sein.
Reduzieren wir das "Schreibhaus" und das "Schreibhaus startet neu" auf ein Blog. Weder die Idee des Hauses noch der Versuch seiner Neubelebung haben funktioniert. Vielleicht habe ich zu viele Baustellen, vielleicht bin ich erschöpft. Ein paar Worte möchte ich jetzt schon über die Idee oder Philosophie des Schreibhauses verlieren: es sollte zum Dialog, zur kreativen Zusammenarbeit, zur gegenseitigen Unterstützung, zum Autoren Selfempowerment einladen und dienen und den Geniekult durchbrechen zugunsten eines gemeinsamen kreativen Wirkens. Ich halte diese Idee für zeitgemäß, die Poetik des kollaborativen, vernetzten Schreibens für entwickelbar, ja geradezu zum Greifen nahe. Die technischen Möglichkeiten dazu sind vorhanden, was am Anfang des Schreibhauses 1994 noch nicht der Fall war. Die Zeit hat der Idee wundervoll in die Hände gespielt, dass der Geniekult überholt ist zugunsten einer kollektiv vernetzten ästhetischen Kommunikation, und doch sieht die Realität des Schreibhauses anders aus. Woran könnte das nur liegen? Ich müsste die Idee etwas ausführen. Aber ich war mit ihr ziemlich allein. Die kreativen Schreibschulen überholten das Schreibhaus im neuen Jahrhundert rechts mit großem Blendwerk von Patentrezepten, wwie man gute Romane schreibt. Aber das ist nicht die wahre Ursache, warum das Schreibhaus kläglich vor sich hin dümpelt. Das muss besser analysiert werden.
Wenn ich mir das bisher Geschriebene anschaue, wird das Blog "Archiv für ungeschriebene Texte" plastisch und sinnvoll. Werde ich je die oben genannte Analyse schreiben? Welchen Erkenntniswert kann ich dahinter vermuten? Weiß ich nicht im Grunde jetzt schon, was am Ende herauskommen wird - zumindest, was das Schreibhaus anbelangt?
Vor einer Woche hätte ich mit Sicherheit geschrieben: ja, ich kenne das Ergebnis. Vor einer Woche hätte ich auch keinen Eintrag "summa summarum" angefangen. Inzwischen ist etwas anders, etwas viel glücklicher als vorher: die Scherben fügen sich wie umherfliegende Teilchen zu einem komplexen Molekül zusammen. Entsteht aus der Ursuppe der Fragmente ein lebendiges Ganzes, das irgendwann zu atmen beginnt? Ich hätte es nicht zu hoffen gewagt. Nun aber sieht es für mich anders aus: ich habe Hoffnung, meine Ursuppe lebendig atmen zu erleben. Vielleicht werden andere das hässliche Baby belächeln oder bemitleiden, mich aber wird es überglücklich machen. Aber wie gesagt: Vielleicht! Noch ist nur die Hoffnung da.
Aber war sie nicht immer da, als ein neues Schreibprojekt oder eine Unternehmung begann? Ist so nicht diese Ursuppe entstanden? Vielleicht kommt ein weiteres Element hinzu, vielleicht das entscheidende, was dem Ganzen Leben einhaucht. Wer weiß das schon? Und dann lebt dieses Konglomerat. Es ist nicht mehr ein Zellhaufen, nicht eine Suppe loser Fragmente. Es ist nicht spirituell gemeint, eher sozial und wirkungsgeschichtlich. Immer mehr Menschen nehmen es wahr und verbinden sich damit, ohne dass dogmatische, schulische, lehrmeisterliche Strukturen entstehen, keine versteinerten Verhältnisse, sondern etwas Lebendiges. Einige werden es bereits erkannt haben, die Idee ist nicht neu: Literatur wie Blütenstaub. Die Fragmente werden durch die Luft, durch die Atmosphäre, getragen und vermischen sich zu neuen Blüten und Formen. Kann man davon im Zeitalter der genmanipulierten Agrarpflanzen überhaupt noch ernsthaft träumen? Oh ja! Darin bin ich Romantiker.
Summa summarum eine Zwischenbilanz: ein kollektivistischer Poetologe, ein epikureischer Gärtner, ein Romantiker. Die Etiketten werden mich nicht festnageln.
Weiter: die "Kynosophie" hebe ich mir bis zum Schluss auf. Warum nicht weiter mit "Globalkultur"? Globalkultur ist ein schlichtes Konstrukt, es wird kein literarisches oder philosophisches Fragment. Es ist eine Rechtsform, eine juristische Person, die keine eigenen Ideen entwickeln und realisieren kann. Sie ist in die Kulturlandschaft gesetzt, um der Bürokratie etwas anzubieten, was sie als förderfähig erkennen kann, ohne ihre Förderwürdigkeit beurteilen zu können. Kulturell, ästhetisch, sozial, philosophisch oder politisch fehlt ihr dieses Erkenntnisvermögen. Aber eine Rechtsform und Buchhaltung kann sie erkennen. Natürlich hat Globalkultur eine Philosophie, aber diese ist dieselbe wie in allen anderen Punkten. Vielleicht unterschätze ich die Globalkultur, und sie wird das Herz des zu pulsieren beginnenden Fragmentenkonglomerats. Ich muss die Globalkultur nicht kleinreden! Sie ist die Firma meiner Ideen, und das ist zugleich ihre größte Schwäche. Vielleicht aber verkehrt sich genau das eines nahen Tages in sein Gegenteil. Dann aber verhält es sich mit "Globalkultur" und "Globalkultur-Academy" wie mit dem "Schreibhaus" und "Schreibhaus startet neu". Also reduzieren sich die Blogs auf sieben.
Das "Hardenberg-Projekt" liegt mir besonders am Herzen, auch wenn ich große Schwierigkeiten habe, damit offen und ehrlich umzugehen. Es ist eine sozio-literarische Recherche, aber damit könnte ich einigen Leuten auf die Füße treten. Meine fiktive Figur Niklas Hardenberg beschließt eines Tages, in meine Welt überzuwechseln. Er möchte mit mir gemeinsam durch die freie Kulturszene ziehen und schauen, wo er am liebsten bleiben würde. Ich biete meinem Lieblingsinvestigator eine andere Herausforderung an, was soll er in meiner Welt? Sie ist das Ende der Fiktion. In der 1002 Nacht ist Scheherazade tot, geköpft. Der Sultan sitzt auf seinem Diwan und schweigt. Was ist geschehen? War sie nicht nicht begnadigt? Aber nein, das interessiert Niklas Hardenberg nicht. Er sieht es als ein reines Ablenkungsmanöver. Er bleibt dabei: er will in meine Welt. Das könnte ein wundervoller Blogroman sein. Warum habe ich ihn überhaupt als Google-Doc angefangen? Wahrscheinlich wollte ich wieder Kommunikation suchen und zu Kommentaren oder zum Mitschreiben ermuntern. Kommentare wären auch im Blog möglich, und wahrscheinlich möchte ich auch nicht viel mehr von meiner Autorschaft preisgeben. Geschrieben sind 28724 Zeichen, drei Folgen. Der Titel verrät die Absicht, in 40 Folgen fertig zu werden. Aus dem Hardenberg-Projekt könnte auch sehr leicht ein Endlosroman werden wie SOKRATES. Aber am 26. September 2019 begonnen, fristet der "Roman" eher ein Schattendasein. Dafür gibt es ein Hardenberg-Blog mit sechs Einträgen und ein Youtube-Video. Das Hardenberg-Projekt ist von mir zwar stiefmütterlich behandelt worden, aber mir ist, als könnte ich es jeden Tag wieder aufnehmen. Nicht vergessen sollte ich, dass mit dem Hardenberg-Projekt der Beginn der Globalkultur zusammenhängt. Freunde, denen das Vorhaben mit Hardenberg gefiel, wollten unterstützend in die kooperative Kulturarbeit einsteigen. Aber alles beruhte diesbezüglich auf Illusionen.
Die fiktiven Dialoge mit Hardenberg sind reizvoll und durchaus auch kontrovers. Ohne Hardenberg könnte ich diese Dialoge nicht führen, sie sind weit mehr als Selbstgespräche. Und sie sind mehr Gespräch, als ich mit nicht-fiktiven Freunden je führen konnte. Stilistisch macht es mir aber Schwierigkeiten, dass wir uns nicht auf einer Realitätsebene begegnen, sondern Niklas Hardenberg im Text in meinem Kopf existiert, weil ich mich ja mit ihm nicht nur durch die fiktive Welt bewegen will, sondern durch meine Realität wandeln. Und in meiner Realität existiert er nun einmal nur in meinem Kopf. Aber diese meine Realität erlaubt mir kaum, durch die Einrichtungen der freien Szene zu gehen. Vormittags schlafe oder schreibe ich, plane und sinniere geplagt von Melancholie, nachmittags gehe ich mit meinen Hundefreunden stundenlang spazieren, und ein Teil des Abends gehört auch meinen Hundefreunden und dem Essen und Regenerieren. Manchmal aber auch dem Schreiben.
Mit den Hundefreunden komme ich nun endlich zur Kynosophie: ich habe dieses Wort aus griechisch "Kynos", der Hund und "sophie", die Weisheit, geschöpft. Es soll bedeuten, dass wir Menschen von der Weisheit der Hunde lernen können, wenn wir uns sensibel und empathisch darauf einlassen. Ich rekurriere dabei auf den legendären antiken Philosophen Diogenes von Sinope. Er gilt als der Begründer des Zynismus, was etymologisch auch auf "kynos" zurückgeht. Diogenes soll den Beinamen "der Hund" erhalten haben, weil er bissig, schamlos und obdachlos wie ein Straßenhund gelebt haben und in einer Tonne gehaust haben soll. Seiner Auffassung nach galt die Bedürfnislosigkeit als hohes Ziel zu erreichen. Er ließ nicht nur seinen einzigen Sklaven ziehen, er soll auch seinen Trinkbecher weggeworfen haben, als er einen Jungen mit der hohlen Hand aus einem Brunnen trinken sah. Die Dinge, die man besitzt, ergreifen Besitz von einem. Dem wollte sich Diogenes schon entziehen. Auch gesellschaftliches Ansehen und Hierarchie sollen Diogenes nichts bedeutet haben. Alexander dem Großen, der zu Diogenes kam, um mit ihm zu philophieren, und er könne sich als Honorar wünschen, was er wolle, soll er geantwortet haben: "Geh mir aus der Sonne!" Nach einer anderen Legende soll er am hellichten Tage mit einer Laterne über den Marktplatz gegangen und den Menschen ins Gesicht geleuchtet und auf die Frage, was das denn solle, geantwortet haben: "Ich suche Menschen". Hier berühren sich womöglich Theaterperformance und philosophischer Sinngehalt.
Ich aber sehe bei alldem noch die Möglichkeit der Umdeutung des Zynismus. Es geht nicht um eine bissige Ablehnung menschlicher, sozialer Konventionen, sondern um den Versuch ihrer Neubegründung. Weniger rationalistisch, weniger durch Besitz und sozialen Status, sondern mehr durch authentische Lebendigkeit. Und davon, was damit gemeint sein könnte, liefern die Hunde ein anschauliches Beispiel, wenn man lernt, sie phänomenologisch durch Einklammerung eigener Urteile und Sichtweisen, mit empathischen Augen zu betrachten. Das wäre ein kynosophischer Ansatz in phänomenologischer Subjekt-Objekt-Einheit, die vereinfacht ausgedrückt besagt, dass die Beobachtungsperspektive die Erscheinungsweise des Beobachteten beeinflusst. In der Teilchenphysik könnten wir an die Heisenbergsche Unschärferelation denken, ohne dass damit alles ausgeleuchtet und erklärt wäre. Vielmehr tut sich hier wieder ein weiterer ungeschriebener Text auf.
Legenden übertreiben, sie müssen spektakulär sein, um zu bestehen. In dieser Übertreibung gerät womöglich Diogenes zur Karikatur als Zyniker im heute gebräuchlichen Sinne. Kann er aber nicht auch ein Kynosoph gewesen sein, der gedanklich wie rhetorisch Platon ebenbürtig war? Würde das dann womöglich bedeuten, dass ich Platon ebenbürtig sein müsste, um Diogenes als Kynosophen auferstehen zu lassen, wie Platon Sokrates auferstehen ließ? Meine "Politeia" gehörte auf jeden Fall ins Archiv für ungeschriebene Texte. Hier ist aber ein Blütenstaub, der bei anderen Philosophen andere Blüten bestäuben könnte.
Wenn ich die Kraft in mir finde, möchte ich an dieser Stelle gerne weiterdenken.
Könnte ich dabei dem Wahn verfallen, eine Globalkultur-Akademie zu gründen, dessen Hauptfigur Diogenes von Sinope sein könnte? Da höre ich schon meinen Niklas Hardenberg rufen: "Hey, dann bin ich aber seine Reinkarnation! Und ich werde mich nicht mit Scheherazade abspeisen lassen!"
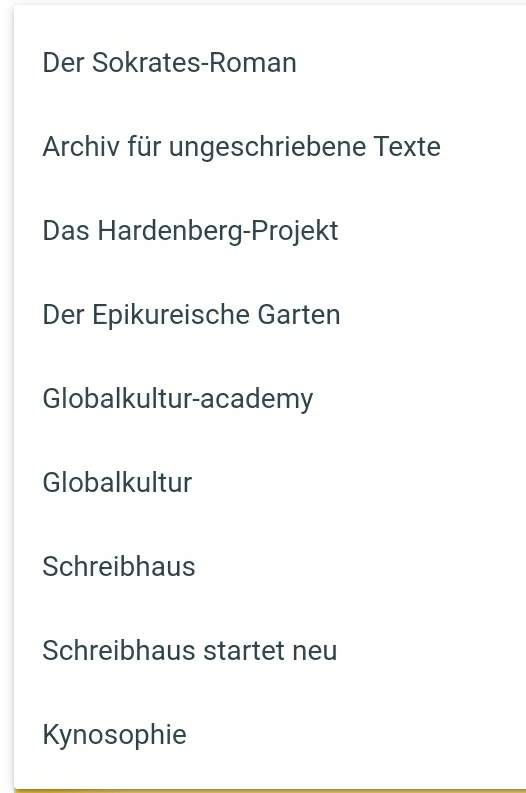
Kommentare
Kommentar veröffentlichen